Morton Rhue hat Humor!

Liebe Freunde,
mein Donnerstag war reich an Schnappschüssen und Schlaglichtern. Zum Beweis sehen Sie hier ein Foto von der Verleihung des Leipziger Buchmessepreises 2017!

Aber das ahnen Sie sicher. Wenn Sie Preisträger googeln wollten, würden Sie nicht hier auf meiner Seite herumhängen und schlecht hingeräumte Kühlschränke betrachten.

Und der Haufen Jacken dahinter macht es nicht besser.
MVB: Buchempfehlung per Gesichtserkennung
Nachdem ich auf der letzten Messe von der begehbaren 3D-Vorschau umgehauen war, stellt mir MVB-PR Markus Fertig deren neuestes Projekt vor: Die Buchempfehlung per Gesichtserkennung.

Dieses Robbi-Tobbi-Dings liest Ihr Gesicht und empfiehlt Ihnen dann ein Buch. Und zwar aufgrund Ihres Gesichts. Das ist ja der Haken dabei. Aber rein technisch funktioniert es, und das ist das Faszinierende.
Hier ist eine künstliche Intelligenz am Werk: Ich sehe offensichtlich intellektuell und humorvoll aus und besuche gerade eine Buchmesse, also könnte ich Horst Evers mögen.


Der Tipp kann aber auch fehlgehen:

Am lustigsten war dieser TV-Journalist, der sich über mich aufregte, weil ich ihm dauernd im Bild war.



Am Gemeinschaftsstand von Börsenverein und Frankfurtmesse treffe ich auch Frau Roelle und Frau Fiala von der Frankfurter Buchmesse. Zu dritt vermissen wir Maren Ongsiek, die eigentlich sonst auf diesen Fotos immer mit dabei ist. Ich sagte ja auch, dass ich eine neue Messefee habe, aber ich kam noch nicht dazu, sie Ihnen vorzustellen. Das schaffe ich hoffentlich morgen.

Alles in allem freue ich mich also immer, wenn der MVB – der Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels – mich zu neuen Mätzchen einlädt.

Wildschweinkeule bei Lojze Wieser
Ich hatte es gestern angekündigt, und ich mache es wahr. Wenn Sie eine frische, aber dabei gut abgehangene Schinkensäbelei in Großaufnahme sehen, dann bin ich wieder beim Wieser-Verlag!



Und das tue ich sehr gerne. Posten, meine ich, neben beißen.
Interview mit Kirsten Reinhardt: Der Kaugummigraf
Ich freue mich nun auf mein erstes Interview dieser Messe. Seit die Kinderbuchautorin Kirsten Reinhardt 2011 für ihr allererstes Manuskrip ausgezeichnet wurde, ist der Carlsen-Verlag für Sie da. Bei Carlsen kam zuerst Fennymores Reisen und dann Die haarige Geschichte von Olga, Henrike und dem Austauschfranzosen. Nun hat Frau Reinhardt ihr drittes Buch veröffentlicht, und das handelt vom Kaugummigrafen.
BuchMarkt traf die Fachfrau für Geschichten, die einen nicht mehr loslassen.

BuchMarkt: Wie kommt denn ein unveröffentlichtes Manuskript zu einem Preis?
Kirsten Reinhardt: Indem man sich für einen Preis bewirbt, wo man unveröffentlichte Manuskripte einreichen darf…?
Ja, meine Fragen sind alle in der Art.
(lacht)
Der Kaugummigraf fällt durch etliche Charakterzüge auf, die erst einmal schräg anmuten, aber die man heute immer öfter antrifft. Er zieht sich zurück, er ist sehr auf seine Rituale bedacht, um seinen inneren Frieden zu gewährleisten. Ist der Eigenbrötler der Bonvivant von heute?
Nein, das ist eher ein intuitiver Zufall. Mir ist gar nicht klar, dass das ein Typus ist oder dass es den heutzutage öfter gibt.
Ich behaupte, dass der Einzelgänger mittlerweile in der Populärkultur angekommen ist.
Nein, das hatte ich nicht im Blick, als ich den Grafen erschuf. Die Figuren entstehen, und dann sind sie da. Ich plane vorher nicht, wie ich diese Figuren gestalten will. Der Graf ist so gewachsen.
Dann ist er sehr zeitgenössisch gewachsen.
Möglicherweise. Obwohl man ja auch beobachten kann, dass das gerade bei älteren Leuten vielleicht eher ein männlicher Zug ist –
– statt ein postmoderner?
– ja, dass es die Männer sind, die eher verschroben werden und sich zurückziehen, während ältere Frauen es sind, die den Kontakt zur Außenwelt halten.
Wieso stoßen wir immer wieder auf Grafen in der Literatur? Wieso ist es nicht mal ein Lord oder ein Baron, sondern immer der mysteriöse Graf?
(denkt nach)…Lord Helmchen! Aber im Ernst: Ein Lord klingt eher nach England und nach vornehm, aber ein Graf klingt zuallererst altertümlich. Man lernt so selten einen echten Grafen kennen. In dem Titel „Graf“ finde ich auch das Ferne, das Unerreichbare, vielleicht auch ein wenig das Altmodische aus einer vergessenen Zeit.
Schulen und Waisenhäuser gehören zu unseren sozialsten und mitmenschlichsten Errungenschaften, um die Familie zu ergänzen oder zu ersetzen, wo nötig. Und dennoch kommen Schulen sehr oft und Waisenhäuser praktisch immer schlecht weg in der Kinder- und Jugendliteratur. Wieso ist das so?
Worauf Sie alles achten! Natürlich macht es mehr Spaß, das Schreckliche zu beschreiben als das Alltägliche. Aber Sie haben ja recht. Jetzt, wo Sie es sagen, könnte ich mir auch gut vorstellen, einmal eine Geschichte zu schreiben über das lustige, tolle Waisenhaus, wo es jeden Morgen Pfannkuchen gibt.
Das gäbe es zumindest noch nicht. Die Schule als Ort der Handlung ist da schon ausgewogener angelegt – bei Kästner gibt es Klassengemeinschaft im fliegenden Klassenzimmer, und egal wie gefährlich Hogwarts auch sein mag, es ist eine Schule, wo wir alle eigentlich gerne hinwollen.
Aber so arbeite ich ja nicht. Die Ideen kommen, und dann sind sie gut oder eben nicht. Ich wäge nicht vorher ab, wie originell oder wie gesucht eine Idee vielleicht ist oder in welches Konzept sie am besten passt. Beim Kaugummigrafen liegt das Trauma in der Kindheit, und das Verlassensein hat hier seinen Ursprung in einem Waisenhaus. Es passte einfach sehr gut in meine Geschichte. Ich wusste gar nicht, ob ich das darf.
Wieso sollten Sie nicht?
Weil ich selber diese Erfahrungen gar nicht habe. Und weil ich da eher auf Erfahrungen mit Kinderliteratur zurückgreife. Das viktorianische Waisenhaus wie bei Oliver Twist gibt es ja so heute nicht mehr.
Und moderne Waisenhäuser?
Die Geschichte der DDR-Waisenhäuser, die erst in jüngster Vergangenheit aufgearbeitet werden musste, ist ein Beispiel. Das sind heute auch Erwachsene und ältere Menschen, die auf ihre Kindheit zurückblicken, ohne dass sie auf Charles Dickens zurückgreifen müssen.
Das Waisenhaus funktioniert als literarisches Element, solange es elternlose Kinder geben wird?
Ja, das böse Waisenhaus ist einfach ein funktionierendes Klischee: Man hat sofort ein Bild, eine Stimmung, eine Greifbarkeit vor Augen.
Harry Potter hätte es im Waisenhaus ja sicher besser gehabt als bei seinen Pflegeeltern.
Das außerdem!
Was haben Sie denn in Ihrer Kindheit gemocht und gelesen?
„Das fliegende Klassenzimmer“ war eines meiner absoluten Lieblingsbücher, obwohl kein einziges Mädchen darin vorkommt. Aber weil ich mich mit allen Jungs identifiziert habe, habe ich das damals gar nicht bemerkt. Roald Dahl habe ich gerne gelesen, „Mathilda“ und „Hexen hexen.“
Also klassische Geschichten von Kindern ohne Eltern?
Da haben wir es wieder.
Wie schreibt man für Kinder? Kinder sind zwar immer sehr unterschiedlich in ihren Ansprüchen, aber sie sind ja auch ein gnadenlos authentisches Publikum.
Das lerne ich alles erst noch. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, habe ich mir nicht vorgenommen, ein Kinderbuch zu schreiben. Ich habe angefangen zu schreiben, weil ich eine Geschichte erzählen wollte, die ich selber auch gerne lesen will. Und erst währenddessen habe ich gemerkt, dass ich anscheinend für Kinder schreibe.
Und hatten Sie nach dieser Erkenntnis ein konkreteres Ziel vor Augen?
Ich will es schaffen, dass die Kinder nach einem Buch unbedingt noch ein Buch lesen wollen. Dass sie bedauern, wenn ein Buch endet. Dass sie spüren, dass ich eine Welt bieten kann, die sie betreten können. Dann hat sich alle Mühe gelohnt.
Gab es Ernüchterungen in diesem Prozess?
Natürlich musste ich lernen, dass es diese und jene Art von Schule gibt, dass es ganze Debatten darüber gibt, wie ein Kinderbuch geschrieben gehört.
Und wo suchen Sie da ihr eigenes Maß?
Man muss spüren, wie die Geschichte erzählt werden will, nicht suchen, was den Kindern gefallen oder missfallen könnte. Man muss Kinder als Publikum ernst nehmen, auf Augenhöhe erzählen und ihnen auch etwas zutrauen.
Gilt das nur für die Leser zuhause oder auch für das Live-Publikum?
Ich finde, eine Lesung ist immer die Feuerprobe. Wenn man Kindern etwas vorliest, was nicht funktioniert, dann bekommt man das live um die Ohren gehauen.
Vielen Dank für dieses Gespräch!

Mittagssuppe bei dtv
Eigentlich müsste diese Rubrik ja eher heißen: KEINE Mittagssuppe am Stand der Frankfurter Buchmesse mehr. Die wurde abbeschlossen. Entwegfernt. Nüscht mehr.
Nicht jeder konnte sich auf diesen Ernstfall so gut vorbereiten wie ich. Die Edition Ruprecht war davon so überrumpelt, dass sie vor lauter Verzweiflung ein Foto davon machte, wie es keine Suppe gibt.

Aber zum Glück hatte ich einen Geheimtipp, dass ausgerechnet das Müchner Verlagshaus dtv mit dem Frankfurter Leibgericht einspringen würde. Und tatsächlich:

Und bei dtv gibt es ja nicht nur Suppe, sondern auch jede Menge schöner Menschen:




Es war so gute Stimmung bei dtv, das war fast 0,8 Lübbe.
Interview mit Morton Rhue bei Ravensbhue
Etwa ein bis zwei Nanosekunden vor der Messe rief Ravensburger an, sie hätten Morton Rhue am Stand! Und ob ich denn Lust hätte. Na, und wie ich Lust hatte! Meine Damen und Herren, Morton Rhue. Beziehungsweise:
Todd Strasser ist ein 66jähriger Amerikaner aus New York, der seit den 80ern Action- und Abenteuerbücher liefert. Aber ab und zu schreibt Todd Strasser auch gerne ernste Bücher, die verstörend sind und nachdenklich machen. Dann verkauft er diese Bücher als Morton Rhue in Deutschland. Die Welle ist aus dem Kanon deutscher Jugendbücher nicht mehr wegzudenken.
Wie alle amerikanischen Autoren, die ich jemals auf Messen traf, war auch Mort höflich, freundlich, interessiert und aufmerksam, und es machte Spaß, mit ihm zu plaudern.

BuchMarkt: Wie französisch wünschen Sie Ihren Namen denn ausgesprochen?
Morton Rhue: Ach, ich weiß auch nicht. Ich hatte zwar ein wenig Französisch in der Schule, aber was uns Amerikanern gar nicht liegt, ist die Aussprache. Darin war ich auch überhaupt nicht gut. Also für mich reicht… (spricht es wie John Wayne aus) „Mort’n Row“. Ich weiß nicht wie man das richtig ausspricht, so vielleicht: „Morton Rooooww“ (es klingt immer noch wie John Wayne.)
(ich selbst spitze die Lippen möglichst demonstrativ-frankophon) Versuchen Sie: Mortohn Rü!
Achh herrje.
In Deutschland ist die Welle ein Riesenerfolg, und mehr noch: Es ist DAS Morton-Rhue-Buch schlechthin. Ist das in anderen Ländern auch so?
Die Welle ist sicherlich in sehr vielen Ländern erfolgreich, aber Deutschland ist beispiellos. Auch in den Vereinigten Staaten wird es oft im Unterricht gelesen, aber das kommt an Deutschland gar nicht heran.
Haben Sie die deutsche Verfilmung gesehen?
Ja, und ich fand sie großartig, bis auf das Ende.
Die Welle wird gern als „typische“ Schullektüre gesehen. Ist das ein Nachteil oder ein Vorteil?
Was? Das habe ich noch nie gehört, dass die Welle „typisch“ für Schulen sei. Das wüsste ich aber. Wahrscheinlich missverstehe ich Sie.
Also gut: In jeder Buchhandlung gibt es dieses eine Regal. Wenn ein Schüler in den Laden kommt und lustlos sagt, er müsse ein Buch für den Unterricht besprechen, das seinem Lehrer gefällt –
Ooooh, ja. Ja. Ich verstehe.
– und es darf nicht Harry Potter sein oder sonstwie Spaß machen. Dann haben wir dieses eine Regal, wo all diese Schullektürenklassiker stehen…
Ja, ja, ja. Sprechen Sie es nicht aus.
…und da steht dann auch Morton Rhue.
Das sind all die ernsten, schweren und langweiligen Bücher, die keiner gerne freiwillig liest.
Ja.
Ich weiß, was Sie meinen. Mir war nicht klar, dass es dafür ein eigenes Regal gibt. (lacht) Die Abteilung „Dieses Buch wird Dir keinen Spaß machen“.
Nein, nein, wir nennen es die Abteilung „Was Lehrern gefällt.“ Das hilft den Händlern bei der Zuordnung.
(denkt nach, lacht dann) Und es hilft auch den Autoren, denke ich. Wenn das dazu beiträgt, dass die Leute, die nach Morton Rhue suchen, wenigstens wissen, wo sie suchen müssen, dann akzeptiere ich das. Damit kann ich wohl leben, denke ich.
Warum haben Sie eine Glückskeksfabrik eröffnet, gerade als ihre literarische Karriere in Schwung kam?
So war das nicht. Als ich anfing zu schreiben, musste ich mir einen Lebensunterhalt suchen, der mir das Schreiben auch ermöglichte. Für mein erstes Buch bekam ich 3000 $, das war großartig, aber davon kann man ja nicht lange leben. Also investierte ich in die Glückskeksfabrik und wurde Halbtagsunternehmer, während ich anderen Halbtags Autor bleiben konnte.

In Ihrem Buch Creature nähern Sie sich der Moby-Dick-Geschichte an. Mochten Sie Moby Dick in Ihrer Jugend?
Nein.
Was?
Ich habe gerade ein Buch ÜBER das Lesen von Moby Dick gelesen. Es hieß: Warum wir Moby Dick lesen. Darauf brauchte ich wirklich eine Antwort, denn eigentlich ist Moby Dick langatmig und dick und endlos. Wenn Sie für immer einschlafen wollen und niemals mehr ein Buch anfassen wollen, dann müssen Sie nur Moby Dick lesen.
Es steht also in dieser Abteilung „Bücher, die Lehrern gefallen“
Ha, das ist die Mutter aller Bücher in dieser Abteilung! Aber so jedenfalls kam ich überhaupt zu dem Thema Moby Dick.
Negative approach.
Sehr wohl. Aber als ich dann die Handlung entlehnte, wollte ich auch die Namen benutzen, damit es nicht wie heimlich geklaut wirkt, sondern wie ehrlich entliehen. Und das nutzt übrigens auch umgekehrt: Wenn die Jugendlichen später auf Moby Dick in der Literatur stoßen, dann kennen sie die Namen schon aus meiner Version.
Aus ihrer Hommage.
Ah, eine Hommage, genau. (lacht und versucht sich wieder in grauenhaftem Französisch) Une Hommage sans Bla Bla Oui.
Wie hat Ihnen Gregory Peck als Ahab gefallen? Einige sagen ja, er sei fehlbesetzt gewesen, dieser aufrechte Stecken habe so gar nichts Besessenes gehabt.
Nein, ich fand, er war großartig. Er war der filmische Ur-Ahab.
Creature passt als abenteuerlicher Sci-Fi-Unterhaltungsroman so gar nicht in das anspruchsvolle Portfolio von Morton Rhue?
Das liegt nur daran, dass deutsche Verlage meine anspruchsvollen Sachen bevorzugen. In den Staaten habe ich jede Menge Abenteuer- und Sci-Fi-Schmöker als Todd Strasser veröffentlicht – die wurden nur nie übersetzt.

Und so kommen wir zu Ihrem anderen aktuellen Buch, das schon eher den vertrauten sozialkritischen und explosiven Bezug herstellt: Dschihad online. Wie lautet sein englischer Titel?
Es hat keinen englischen Titel, es wurde zuhause nicht verlegt.
Kann man dieses Buch in den Vereinigten Staaten denn veröffentlichen?
Wenn ich einen Verleger finde, dann vielleicht. Das Buch war eigentlich schon fast gedruckt, aber als dann ein Klappentext veröffentlicht wurde, regten sich einige Menschen allein über den angekündigten Inhalt auf, ohne es je gelesen zu haben. Keiner wolle ein Buch über Moslems lesen, das ein alter weißer Amerikaner geschrieben habe. Aber dabei ist das doch gerade der Grund, warum ich schreibe. Die ganze Idee hinter einem Buch ist doch, eine andere Welt zu erschließen und zu reflektieren.
Vielleicht wollen die Leute über gewisse Dinge nicht nachdenken, weil das zu beunruhigend ist.
Vielleicht hatte mein Verleger einfach Angst, obwohl er immer hinter mir gestanden hat, auch und gerade bei brisanten Themen. Jedenfalls verstehe ich diesen Rückzieher nicht und hoffe, dass nicht mehr dahinter steckt.
Stimmt es, dass Sie in den 80ern sogenannte Novelizations von erfolgreichen Hollywoodfilmen geschrieben haben? Der Roman zum Film war eine fürchterliche Unsitte. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch recherchiert habe, aber haben Sie „Kevin allein zuhaus“ und „Ferris macht blau“ als Romanversionen verfasst?
Ähmmmmmmmmmmm, ja.
Warum?
John Hughes war ein sehr beeindruckender Filmemacher, ich mochte seine Sachen. Der Breakfastclub und Ferris macht blau waren Meilensteine der Jugendpopkultur.
Aber „Kevin allein zuhaus“?
Ich war jung und brauchte das Geld.
Aber Sie hatten doch die Glückskekse!
Meine Frau wollte ein neues Haus. Und das wollte ein neues Dach. Und ich wollte, äh, (gerät ins Schwimmen)…
Sie wollten in Form bleiben.
Und brauchte das Geld. Und John Hughes war wirklich einer der Besten!
Ich danke für dieses Gespräch.
Todd Strassers Visitenkarte ist von seiner Tochter Lia designt:

Bei Ravensburger treffe ich auch rein zufällig die wandernde Buchbloggerin Lea Kaib, gerade als ich mich gefragt habe, ob Lea Kaib dieses Jahr wohl wieder auf der Messe herumbloggt. Letztes Jahr war sie bei Carlsen.

Und ich muss über Ravensburger noch eines sagen:

Tea-Time bei BLV
Womit sich ausgerechnet der Münchner Haus- und Gartenquälverlag BLV das Privileg erworben hat, hier immer besonderes Product Placement zu verdienen, das weiß ich auch nicht mehr. Es wird wohl das ewige Durchfüttern seit Jahrzehnten sein.
Wie jedes Jahr gibt es ein Motto, und dieses Jahr ist es „Endlich durchatmen“. Das ist zwar schon beinahe unerträglich, aber dafür gibt es wenigstens keinen Aufkleber diesmal!

Verlagsintern wird mittlerweile auch ein Farbcode gepflegt, der mit den Büchern harmoniert:

Das Durchatmen am Stand korrespondiert mit einem neuen Teebuch, und daher werden Standgäste dieses Jahr mit einer waschechten bayerischen Tea-Time verwöhnt.


Mein persönliches Highlight am Stand von BLV ist der überraschende wie zufällige Besuch meines Chefredakteurs, des legendären Christian von Zittwitz.

Während Verlagschefin Antje Wolf sich aus seinem Griff zu winden versucht, nutze ich die Gelegenheit zur Flucht, bevor ich noch mehr Tee angeboten bekomme. Danke, Chef, ich schulde Ihnen was.
Fitzeks Autogrammschlange
Erwarten Sie jetzt bloß keine aufregende Geschichte, nur weil der Name „Fitzek“ darin auftaucht. Es war nur so, dass Ehling und ich beim Herumkaspern bemerkt haben, dass sich eine immense Schlange um den BuchMarkt-Stand bildete, die aber dann zum Fitzek führte. Das ist alles.
Hier sind Verleger Holger Ehling, Unternehmensberater Ehrhardt F. Heinold und Kater Karlo dabei, beim harmlosen Posieren für ein Foto zu versagen, während sich hinter uns diese Menschenwarteschlange formiert:



He – Moment mal, was ist denn das für eine Schlange hinter uns?




Ich sagte ja, dass es nicht so eine gute Story wird.
Aber das Foto, wo wir alle nesteln, das gefällt mir gut.
Schnappschüsse aus den Hallen
Hier arbeite ich meinen kleinen Stapel Fotos ab, bevor ich für heute schließe:










Zum Geleit
Dass mein Tag und mein Bericht enden, merken Sie daran, dass ich das tägliche Foto von Iny und Iny Lorentz nicht schuldig bleibe.

…und jetzt sind auch Bücher am Stand.
Es schmerzt mich etwas, dass die BuchMarkt-Redaktion mit den Partys immer extra wartet, bis ich gegangen bin.

Und außerdem muss ja einer im Bunker, äh, im liebreizenden Messehotel sitzen und diese Meldungen hier basteln.
Und apropos basteln: Im aktuellen BuchMarkt machte ich auf meiner mayerschen Doppelseite Witze über Dark Matter bei Goldmann: Dass die riesige Werbekampagne mit dem ach so kostbaren Papier aus Gmund sehr marketingverhaltensauffällig sei. Mit Gmunder Papier werde außerdem, so feixte ich, die Vatikan-Ausgabe vom Playboy gefertigt.
Warum ich das erwähne?
Heute überreichte mir eine Goldmann-Botin dies hier:


Ist das nicht rührend? Also abgesehen davon, dass der Vatikan in Lateinisch drucken lassen würde? Aber iuvenis voluptarius klingt dann halt wieder nicht so lustig wie Prayboy.
Danke, Goldmann.
Jetzt müsst Ihr mir nur noch verraten, wieso der Raumläufer Zeitenläufer heißt, obwohl er dauernd erklärt, dass er eines nicht sei: ein Zeitenläufer?
Aber das sind dann so Spezialprobleme.
(Edizione speciale, hahaha!)
Da freue ich mich gleich doppelt auf den Freitag.
Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, denn ab Samstag wird es sehr voll. Aber das wissen Sie ja nun allmählich.
Herzlichst,
Ihr Matthias Mayer
Litauer, die Sie nicht sofort auf dem Schirm hatten, Teil 2 von 5:

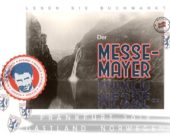
Matthias,
Great article! Can’t wait to learn German so I can see what you said ;-) Seriously, I appreciate the write-up.
Best Wishes, Todd aka Mort
Hey Todd aka monsieur de la Rhue,
it was nice talking to you. Thanks for your comment,
Matthias Mayer