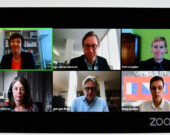Am Freitag wurden die neunten Literaturtage von Litprom unter dem Titel Migration – Literaturen ohne festen Wohnsitz im Frankfurter Literaturhaus eröffnet. Der Andrang war so groß, dass noch Stühle herbeigeschafft werden mussten.
 Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse, stellte in seiner Begrüßung fest: „Europäer schauen aus einem privilegierten Blickwinkel auf das globale Phänomen Migration.“ Die Literatur sei das beste Vehikel für die Erinnerung, zitierte Boos den Schriftsteller Eduardo Halfon aus einem Interview vor wenigen Tagen, das Halfon der taz gab.
Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse, stellte in seiner Begrüßung fest: „Europäer schauen aus einem privilegierten Blickwinkel auf das globale Phänomen Migration.“ Die Literatur sei das beste Vehikel für die Erinnerung, zitierte Boos den Schriftsteller Eduardo Halfon aus einem Interview vor wenigen Tagen, das Halfon der taz gab.
Der Messedirektor würdigte den Ehrengast der diesjährigen Buchmesse: Kanada habe früh erkannt, welche Perspektiven Einwanderung hat.





Carmen Aguirre besucht Deutschland zum ersten Mal. Sechsjährig floh sie mit ihren Eltern aus Chile nach Vancouver, ging später gegen Pinochet in den chilenischen Untergrund und 1990 erneut nach Kanada. Sie studierte Schauspiel und schrieb bislang über 20 Stücke.
Lesley Nneka Arimah, geboren in England und in Nigeria aufgewachsen, lebt heute in den USA. In Nigeria leben ihre Verwandten und Freunde, die sie besucht. Überall müsse man mit gesellschaftlichen und kulturellen Regeln zurecht kommen. „Ich habe viel beobachtet, vielleicht war das eine gute Vorbereitung für eine Schriftstellerin“, sagte sie.
Eduardo Halfon begann mit einer Anekdote: „Als ich das erste Mal nach Deutschland kam, war Trump gerade zum Präsidenten gewählt worden. Und jetzt, beim zweiten Mal? Was mag da passieren?“
Halfon wurde in Guatemala geboren. Als er zehn Jahre alt war, verkaufte der Vater das Haus, die Familie floh vor dem Terror und der Gewalt in die USA nach Nebraska. Er sei ein behütetes Kind gewesen, war praktisch in die Migration hineingeboren worden, ein Großvater stammt aus Polen und hatte Auschwitz überlebt, eine Großmutter stammt aus Ägypten, die andere aus Aleppo. „Ich bin aufgewachsen in einer jüdischen Familie in einem erzkatholischen Land“, stellte er fest. Eigentlich sei er ja Ingenieur, das habe er studiert. Nach seinem Studium in den USA ging er zurück nach Guatemala, gegenwärtig lebt er in Paris.
Wie ist das als Migrant, fühlt man sich einem Land zugehörig?, wollte Kramatschek wissen. „Nigeria ist für mich nicht so weit weg, weil ich viele Verbindungen dorthin habe. Ich bin Nigerianerin und Amerikanerin, so wie ich schwarz und weiblich bin. Das gehört alles zusammen“, erklärte Arimah.
Alle stellten fest, dass es heutige Generationen leichter haben, sich in der Welt zurecht zu finden und in verschiedenen Ländern zu leben. Viel hängt davon ab, wo es Bedingungen gibt, die Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Vor dreißig Jahren seien Farbige in Kanada die Ausnahme gewesen, berichtete Aguirre. Alles war Weiß, das war das Normale. Zumindest bei den großen Studios und Produktionsfirmen. Inzwischen gingen Flüchtlinge, die in den 1990er Jahren aus Chile nach Kanada gekommen waren, wieder zurück.
Halfon antwortete: „Es ist kompliziert.“ Er nutze die Geschichten seiner Familie als Hintergrund, seine Romane seien aber Fiktionen. Mit seinem Buch Der polnische Boxer (2008) habe eine Entwicklung begonnen.
„Ich richte mich nicht nach den Wünschen meiner Leser. Ich will nicht belehren, sondern mit ihnen spielen, sie anregen“, bemerkte Arimah. Kunst sei sehr persönlich.
„Kann man sein eigenes Narrativ in ein anderes hineinschreiben?“, fragte Kramatschek. Aguirre erinnerte an ihr Stück Chile can Carne – „ein schönes Sprachspiel“, bemerkte die Moderatorin. Zur Aufführung seien Menschen aus aller Welt gekommen. Eine wunderbare Erfahrung. Aber es sei schwierig, Stücke in Kanada auf Spanisch auf die Bühne zu bringen, die Leute würden das nicht verstehen – eher noch Mandarin.
Beim Schreiben schaut Arimah in sich hinein. Kultur entwickle sich schneller als die Verlage, fügte die Autorin hinzu. Und Sprache verändere sich mit denen, die sie sprechen.
Zum Thema Sprache äußerte sich Halfon: „Guatemala interessierte mich nicht, aber Spanisch. Sprache ist notwendig, um in neuen Gewässern zu überleben.“ Er habe sein Spanisch verloren, es später beim Lesen wiedergefunden. Halfon schreibt auf Spanisch, obwohl Englisch seine stärkere Sprache sei, wie er einschätzte. „Spanisch ist meine Kindersprache, nicht meine Muttersprache“, erläuterte er.
Bei der Frage nach der Nationalliteratur herrschte auf dem Podium zunächst so etwas wie Ratlosigkeit. Arimah meinte, sie habe das Privileg, Leser in Nigeria und in den USA anzusprechen.
„Kanadische Nationalliteratur bedeutet wahrscheinlich so etwas wie Margaret Atwood. Aber das ändert sich auch gerade“, sagte Aguirre. „Nationalität interessiert mich nicht. Was ist das? Man kann alles sein, wenn man will“, erklärte Halfon.
Arimah fügte zum Schluss hinzu: „Autoren dürfen keine Angst haben, wenn sie schreiben. Sie müssen sich befreien, um arbeiten zu können.“
Am Freitagabend fand noch ein weiteres Gespräch mit Tomer Gardi und Ulrich Noller statt, am Samstag folgten sechs Werkstattgespräche, eine ARTE-Filmvorführung und das Abschlusspodium.
JF